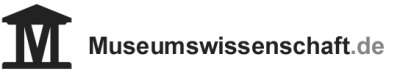Der Ort Messel ist bei Darmstadt und liegt am Rande eines relativ großen und geschlossenen Waldgebietes, das heute als Naherholungsgebiet genutzt wird. Die Grube Messel ist ein stillgelegter Tagebau. Bekannt wurde die sie durch die dort gefundenen und hervorragend erhaltenen Fossilien von Säugetieren, Vögeln, Reptilien, Fischen, Insekten und Pflanzen aus dem Eozän. Das Eozän ist ein Zeitintervall, das vor ca. 56 Millionen begann und vor ca. 34 Millionen Jahren endete. Besonders die Weichteilerhaltung bei Säugetieren macht die dort gefundenen Fossilien einzigartig. Am bekanntesten ist die frühe Pferdeart Propalaeotherium, von der über 70 Individuen gefunden wurden.
Die Grube Messel ist fast 50 Millionen Jahre alt. Damals herrschte paratropisches Klima, d.h. es war damals ziemlich tropisch, das aber auch manchmal von trockenen Zeitabschnitten unterbrochen wurde. Die Grube war früher ein tiefer See, der nach einem Vulkanausbruch entstanden ist. Forschungsbohrungen aus dem Jahr 2001 haben ergeben, dass die Grube ein Maarvulkankrater ist: vor 47 Millionen Jahren bildeten sich im Erdreich rund um Messel Risse. In diesen Rissen stieg Magma nach oben und traf in einigen hundert Metern Tiefe auf Grundwasser. Dies hatte eine gigantische Explosion aus Wasserdampf zur Folge. Es entstand ein riesiges Loch, der Maarvulkankrater. Hier sammelte sich Wasser, so dass im Laufe der Zeit ein See entstand, ein sog. Maarsee. Grube, Rückstands- und Abraumhalde und das ehemalige Firmengelände umfassen ca. 150 Hektar, der aufgelassene Tagebau misst 500 x 800 Meter, zirka 70 Meter tief haben sich Generationen von Bergleuten in den Boden eingegraben und haben im Laufe von 100 Jahren rund 28 Millionen Kubikmeter Ölschiefer und taubes Gestein aus dem Boden geschafft.
Ein archäologischer Traum geht in Erfüllung
In der Grube Messel wurden von 1859 bis 1970 bituminöser Tonstein, Eisenerz und Braunkohle abgebaut und der Tonstein zur Gewinnung von Erdölprodukten verschwelt. Umgangssprachlich werden diese Sedimente auch als Ölschiefer bezeichnet. Die Grundsubstanz von Ölschiefer sind Zersetzungsprodukte aus pflanzlichen und tierischen Resten, nur durch die Verbindung mit dem im Wasser des Sees gelösten Tonpartikeln faulschlammartig ausgeprägt. Im Dünnschliff konnten Algenarten, Pilze, Pollen und Bakterienreste nachgewiesen werden. Eigentlich ist Ölschiefer die falsche Bezeichnung für diesen Tonstein, denn dieser besteht in der Grundsubstanz aus in den See geschwemmten feinsten Tonpartikel, die sich in dem kaum bewegten Seebecken in feinen Schichten auf dem Grund ablagerten, vermischt mit organischen Resten, besonders den abgestorbenen Algen. Die in den oberen, lichtdurchströmten Schichten des Seewassers lebenden Algen starben ständig ab und sanken auf den Seeboden hinab. Dadurch bildeten sich in den tieferen Wasserschichten Schwefelwasserstoff, Kohlendioxid und Methan unter ständigem Entzug von Sauerstoff. Vom Land in den See geschwemmte Pflanzenteile oder Tierkadaver, aber auch verendete Fische, die in die tieferen Regionen des Sees hinabsanken, wurden nicht zersetzt und blieben daher bis heute erhalten. Die organischen Reste und Tonpartikel wurden in 1-20mm starken Bändern abgelagert, die bisweilen von Makroresten wie Blättern oder Tierkadavern „unterbrochen“ waren. An diesen Stellen bildeten sich in der Schichtung kleine oder große Erhebungen. Das Objekt wurde wie in einem Einweckglas mit der nächsten Schicht hermetisch vom darüber liegenden Seewasser abgeriegelt.
Der Ölschiefer wurde in einer Stärke von bis zu 150 Metern abgelagert. Das lässt auf eine Zeitspanne von rund 1,5 Millionen Jahren schließen, während der See bestanden haben muss. Die sehr große Tiefe im Verhältnis zur kleinen Oberfläche erlaubte einen Wasseraustausch durch Konvektion nur in den oberen Wasserschichten, was in der Tiefe zu Sauerstoffmangel führte. In dem subtropischen bis tropischen See konservierten sich deshalb in tiefer gelegenen Wasserschichten und im Schlamm des Sees tote Tiere und Pflanzen, die auf den Grund sanken und versteinerten.
1971 wurde der Tagebau in der Grube Messel eingestellt, das riesige Gelände bliebt wirtschaftlich ungenutzt, die wissenschaftlichen Ausgrabungen gingen allerdings weiter. Dummerweise hatten ein paar findige Müllstrategen die Grube im Visier. Mit der Unterstützung durch das Land Hessen sollte hier eine Mülldeponie entstehen. Der Bau wurde sogar schon begonnen. Vor allen Dingen die Messeler Bürgerinitiative lief Sturm, fast 20 Jahre dauerte der Kampf um den Erhalten der Grube, es ging sogar vor Gericht. Die Grube konnte schließlich durch einen Verfahrensfehler der Müllfans gerettet werden. 1991 kaufte das Land Hessen die Grube. Endgültig gesichert war sie aber erst ab dem 8. Dezember 1995. Seitdem ist die deutsches Weltnaturerbe.
Es wird davon ausgegangen, dass der See samt seiner reichhaltigen Lebensformen gut eineinhalb Millionen Jahre bestand, bevor er verödete. Der See entstand in der sog. Erdneuzeit, Säugetiere konnten sich prächtig entwickeln – im Bereich der Grube Messel sogar sehr vielfältig – ebenso Vögel, Fische, Reptilien, Insekten und Pflanzen.
Ein Bilderbogen zwischen Schildkröten und Urpferdchen
Dass heute so außergewöhnlich viele unterschiedliche Fossilien noch so unglaublich gut erhalten sind, liegt an der einstigen Beschaffenheit des Sees. Er war sehr tief und mir Algen durchsetzt, deswegen gab es ab einer gewissen Tiefe keinen Sauerstoffgehalt mehr. Tote Tiere und abgestorbene Pflanzen, die auf den Seegrund sanken, konnten nicht mehr verrotten. Sie wurden in sandigen Tonstein eingehüllt, dieser versteinerte im Laufe der Jahrmillionen zu Ölschiefer und hält die Tiere bis heute in sich, und zwar so gut, wie kaum irgendwo sonst auf der Welt. Sogar Mageninhalte und Federn konnten sie Forscher entdecken.
Das Bodenwasser des Messel-Sees war sauerstofffrei. Sinkt ein totes Tier auf den Grund eines Gewässers hinab, beginnen Mikroorganismen sofort damit, alles organische Weichgewebe zu zersetzen, wodurch ein Skelett schließlich in seine Einzelknochen zerfällt. Die Sauerstoffarmut hat dies jedoch in Messel verhindert. Unter solchen Bedingungen sind Bakterien nicht in der Lage, die Fette von Leichen vollständig aufzulösen. Aus den frei gesetzten Fettsäuren bildete sich ein wachsartiges, zersetzungsresistentes Leichenwachs und die Kadaver konnten als sog. Fettwachsleichen über mehrere Jahrzehnte hinweg bis zu ihrer vollständigen Einbettung im Seeboden überdauern, ohne zu zerfallen.
Unter den Fossilien der Messeler Ölschiefer haben gerade die Säugetierreste eine besondere Bedeutung erlangt. Zwar hatten sich schon zu Beginn der Kreidezeit, dem Zeitalter vor dem Tertiär, also vor etwa 130 Millionen Jahren, die ersten Säugetiere entwickelt; doch erst nach dem Aussterben der Dinosaurier, am Ende der Kreidezeit, kam es zu ihrer explosionsartigen Entfaltung: Am Beginn des Tertiärs, im Paläozän und auch im Eozän, entstanden viele neue Arten und Gattungen. Damals entwickelte sich der reichverzweigte Stammbaum der Säugetiere. Viele der heute lebenden Säugetiergruppen standen zur Zeut des Messeler Sees erst am Anfang ihrer Entwicklung. Daneben existierten natürlich auch die sehr alten Säugergruppen aus der Kreidezeit, die sich schon gut an ihre Umwelt angepasst hatten und sich fast unverändert bis heute fortgepflanzt haben. Die Säugetierfunde gehören zoologisch zur größten Gruppe der Wirbeltierfunde, die insgesamt wegen ihrer außergewöhnlichen Erhaltung Messel so berühmt gemacht haben. Auch die Artenvielfalt ist beeindruckend. Herausragende Exemplare sind frühe Primatenfunde, ein Ameisenbär, Schuppentiere und die Urpferdchen.
Vier verschiedene Raubfischarten und zahlreiche Amphibien machen einen relativ hohen Prozentsatz der Funde aus. Unter den Reptilien traten fünf Schildkröten, sechs Krokodilarten und verschiedene Vertreter der Schlangen und Eidechsen auf. So der Stand von 1987.
zu den weniger bekannten Fundgruppen aus der Grube Messel gehören auch die Überreste einer den See umgebenden üppigen Flora.
Bildquelle: Falco (Pixabay)