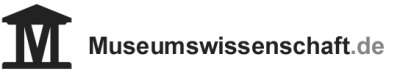Im ersten Teil zum Thema Entsammeln ging es bereits um die Handhabung in Museen in Deutschland. Außerdem wurden bereits der Abgabeprozess sowie die Leitfäden des DMB und ICOM thematisiert. 1996 sprach sich der Deutsche Museumsbund noch dafür aus, dass der Erlös der veräußerten Objekte ausschließlich für den Erwerb neuer Objekte verwendet werden solle. Seit 2001 ist jedoch die Formulierung, dass dies „normalerweise so geschehen solle“ verbreitet. Dass der Erlös für die Finanzierung laufender Betriebskosten eingesetzt wird, ist wahrscheinlich der umstrittenste Aspekt. Kosten für Lagerung, Instandhaltung und Konservierung von Kunstgegenständen beanspruchen wohl den Großteil des jährlichen Museumsbudgets. Das Metropolitan Museum of Art gab 2007 mehr als 50 Millionen Dollar für die Erhaltung und Katalogisierung der Objekte und für wissenschaftliche Publikationen aus, was 29% der Betriebskosten ausmachte. Kosten für Wartungarbeiten beliefen sich auf 18% des Gesamtbudgets.[1] Dieser finanzielle Druck kann Museen auch dazu veranlassen, ihr Sammlungsprofil zu verengen.
Ein Entsammlungsvorhaben kann auch durch Veränderungen der wirtschaftlichen Verhältnisse entstehen. Museen wollen moderne Zentren für Kulturinteressierte sein und bleiben.[2] Somit können sie leichter und in ihren Augen berechtigt Sammlungsgegenstände ausgliedern, die außerhalb des neuen Profils liegen. Die Albright-Knox-Art-Gallery in Buffalo versteigerte 2007 ungefähr 200 Objekte aus ihrer Asien- und Antiquitätensammlung. So konnte das Stiftungskapital erhöht werden, sodass die Konzentration auf den Erwerb moderner und zeitgenössischer Kunst gelegt werden konnte.[3] Auch die Corcoran Gallery sowie die Pennsylvania Academy of Fine Arts gaben europäische Gemälde ab, um sich gänzlich auf ihre amerikanische Sammlung konzentrieren zu können.[4] In den USA werden – anders als in Deutschland – im Wesentlichen drei Gründe anerkannt, weshalb das Entsammeln eine erfoderliche Maßnahme seitens der Museen ist. Denn im Gegensatz zu vielen europäischen Museen stammen ihre Bestände nicht aus königlichen oder fürstlichen Sammlungen, sondern sie erhielten diese von Privatleuten, die ihre Objekte spendeten, ohne dass das Museen hierfür eine konkrete Verwendung hatte.[5] Somit passten viele Objekte nicht mehr in das Sammlungsprofil, weshalb es notwendig war zu entsammeln. Dadurch konnte gewährleistet werden, dass die Sammlung Struktur bekam, Platzprobleme gelöst und finanzielle Schwierigkeiten behoben wurden.[6] Weiterhin wird der pädagogische Auftrag eines Museums zur Legalisierung des Entsammelns genannt, denn Museen sollen der Öffentlichkeit etwas vermitteln.[7] Nach dem amerikanischen Verständnis bestehen Sammlungen, weil sie dem Bildungsauftrag eines Museums dienen.[8]Aus diesem Grund sollen die Sammlungen regelmäßig einer Überprüfung unterzogen werden.

Bildquelle: Pete Linforth (Pixabay.com)
Ein weiterer Grund liegt in der Konfliktbewältigung durch amerikanische Einrichtungen. Da amerikanische Museen private Organisationen sind, unterliegen sie nicht der Pflicht, das nationale kulturelle Erbe zu repräsentieren. Sie sind dadurch wesentlich freier als europäische Museen. Deakzession ist weniger eine ethische als vielmehr eine pragmatische Frage, die handlungsorientiert zu beheben ist.[9] Nicht ausgestellte Objekte werden als „tote Objekte“ und somit als eine Belastung für das Museum angesehen.
Aus diesem Grund ist es legitimiert, diese in Kapital umzuwandeln.[10] Allerdings droht hier die Gefahr, dass die Kunstgegenstände nicht nur Teile des kulturellen Erbes sind, sondern vielmehr zu Handelswaren umfunktioniert werden. Dem französischen Vordenker der Museologie, Georges Henri Rivière, war das Ausmaß seiner Begriffsprägung „Boulimie muséale“ in den 1970er-Jahren wohl nicht klar: Er spricht von einem planvollen Vorgehen anhand eines Erwerbsprogramms mit „Museumsheißhunger“ in einer weit verbreiteten Form, um außergewöhnliche Gelegenheiten auszunutzen oder gar um bedrohte Dinge zu sichern.[11]
Doch droht das Wortspiel \glqq Depot oder Deponie\grqq ~wahr zu werden, denn es bringt die Zwickmühle der Museen zwischen Sammeln und Entsammeln auf den Punkt. Ein striktes Entsammlungsverbot ist allerdings nicht umzusetzen. Dies würde auch aus oben genannten Gründen kaum funktionieren.
Es kann durchaus von Vorteil sein, die Sammlungen zu deakzessionieren, um das Profil zu schärfen oder um andere Sammlungen zu stärken und lebhafter zu gestalten. Wünschenswert wäre vor allem nicht nur ein Leitfaden zum Entsammeln, sondern auch eine Orientierungshilfe oder gar eine Plattform, auf der die Museen sich, beziehungsweise ihre Sammlungsgegenstände (aus)tauschen können. Denn Museen sollen Sammeln und nicht Horten. Die Museen müssen sich selbst im Klaren darüber sein, was sie wollen. Erst dann können sie gezielt sammeln und mitunter auch entsprechend Schenkungen ablehnen. Grundsätzlich sollte eine Abgabe tabu bleiben, ansonsten besteht Gefahr, dass die Archivfunktion der Museen zu wenig berücksichtigt wird. Denn die Hauptfunktion der Museen ist weiterhin das Sammeln. Museen kennen ihre Sammlungsgenese, sie unterziehen sich einem Prozess der Sammlungsprofilierung und -qualifizierung. Aber Sammlungskonzepte sollten Pflicht für Museen sein. Die 2006 begonnene Museumsregistrierung in Niedersachsen fordert von jedem teilnehmenden Museum ein schriftliches Sammlungskonzept, welche allesamt erfasst werden. Auch hier wird die Abgabe thematisiert. Ziel sollte vielmehr eine praktische Anleitung für Museen zum Thema Entsammeln sein. Denn Deakzession bedeutet einen maßvollen Abbau der Sammlungsbestände.
Fußnoten
- [1]vgl. Metropolitan Museum of Art (Hrsg): One Hundred Thirty-seventh Annual Report of the Trustees for the Fiscal Year July 1, 2006, through June 30. New York. 2007. S. 60-62, abrufbar unter: http://metmuseum.org/~/media/Files/About/Annual\%20Reports/2006_2007/EntireAR07WEB.ashx [Stand: 30.07.2016]}
- [2]vgl. Fincham, Derek: Deaccession of art from the public trust. In: Institute of Art and Law (IAL) (Hrsg): Journal of Art, Antiquity \& Law 16,2. London. 2011. S. 1-37, hier S. 1, 31.
- [3]vgl. Fincham, Derek: Deaccession of art from the public trust. In: Institute of Art and Law (IAL) (Hrsg): Journal of Art, Antiquity \& Law 16,2. London. 2011. S. 1-37, hier S. 1, 31; Conforti, Michael: Deaccessioning in American Museums: II – Some Thoughts for England. In: Weil, Stephen E. (Hrsg): A Deaccession Reader. Washington. 1997. S. 73-86, hier S. 73-76.
- [4]vgl. Conforti, Michael: Deaccessioning in American Museums: II – Some Thoughts for England. In: Weil, Stephen E. (Hrgs): A Deaccession Reader. Washington. 1997. S. 73-86, hier, S. 73-76.
- [5]vgl. Cirigliana, Jorja A.: Let Them Sell Art: Why a Broader Deaccession Policy Today Could Save Museums Tomorrow (February 21, 2011). In: University of Southern California (Hrsg): Southern California Interdisciplinary Law Journal, Vol. 20, 2011. S. 365-393, hier S. 365, 384.
- [6]vgl. Ebd.
- [7]§ 216 des New York Education Law erklärt Museen ausdrücklich zu Bildungseinrichtungen
- [8]Conforti, Michael: Deaccessioning in American Museums: II – Some Thoughts for England. In: Weil, Stephen E. (Hrgs): A Deaccession Reader. Washington. 1997. S. 73-86, hier S. 73, 79.
- [9]vgl. ebd., hier S. 73, 80.
- [10]vgl. ebd., hier S. 73, 75.
- [11]Rivière: Georges Henri: La muséologie selon Georges Henri Rivière. Cours de muséologie, Textes et témoignages. Dunod. 1989. S. 172.
Bildquelle: Christopher DeKenipp (Pixabay)